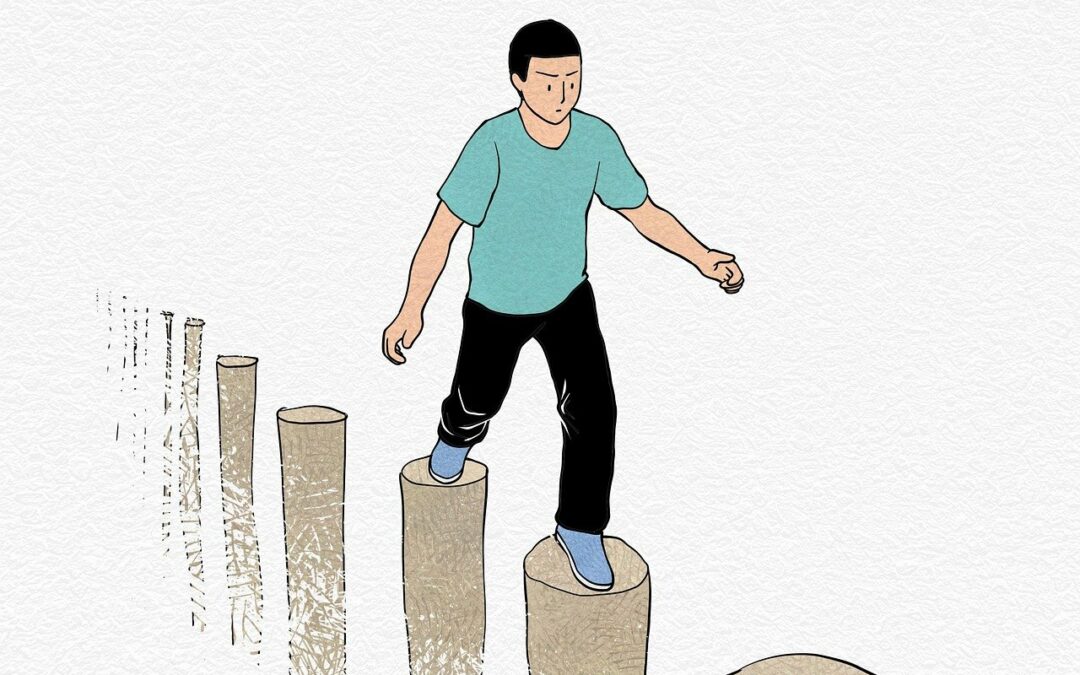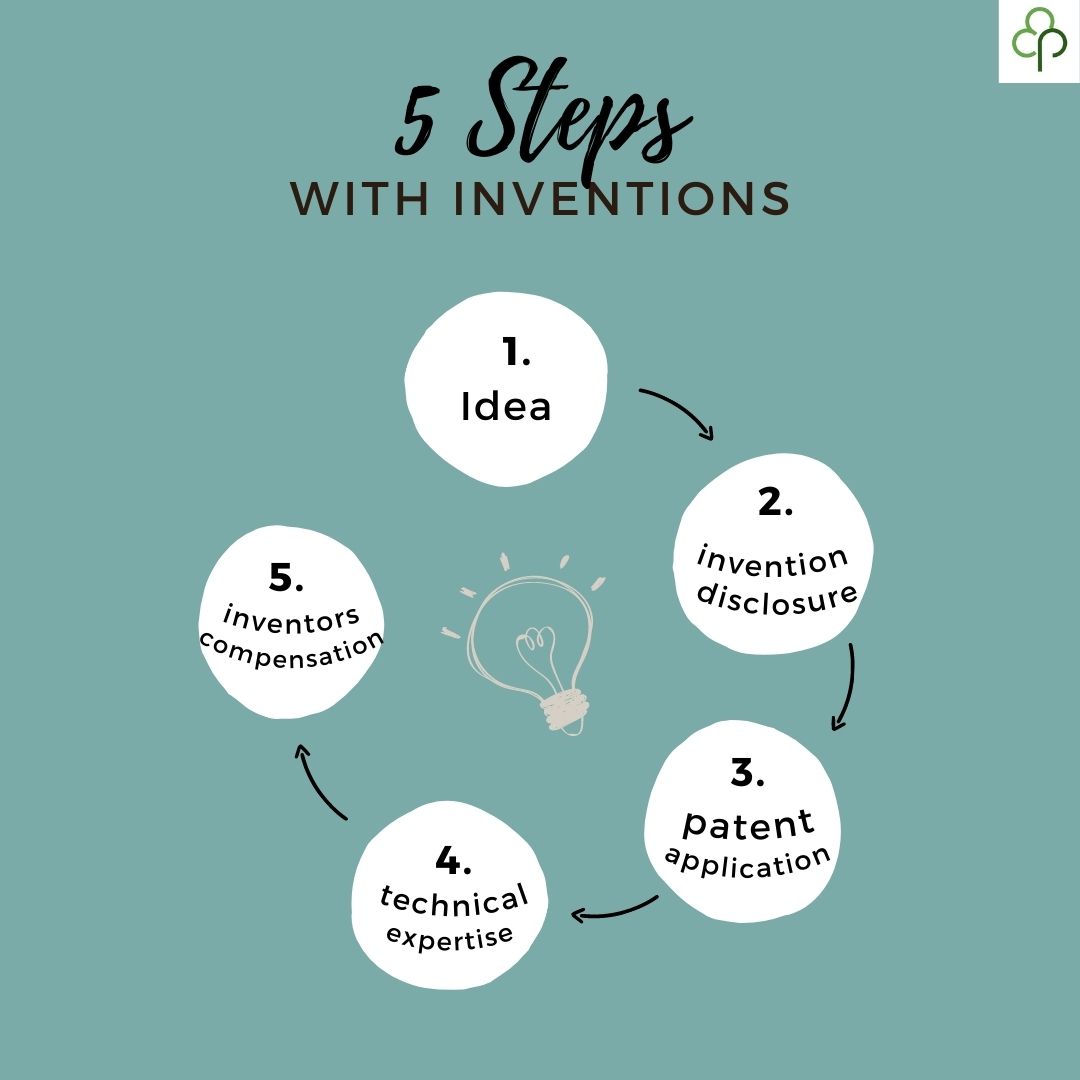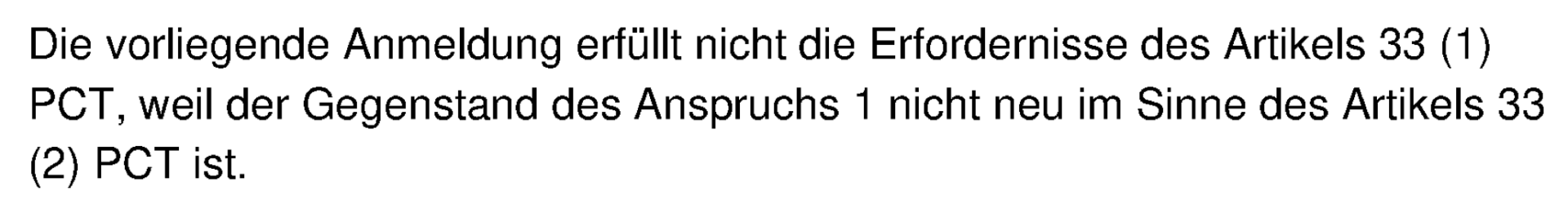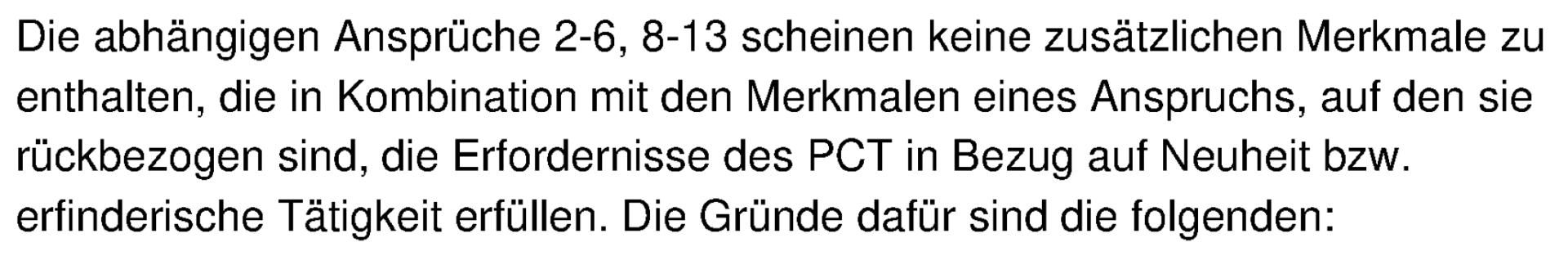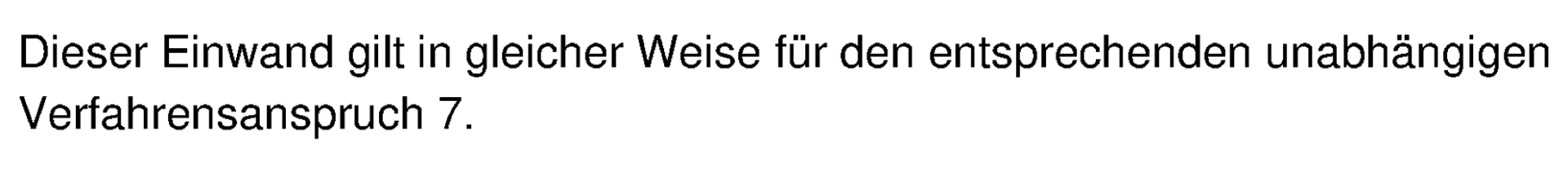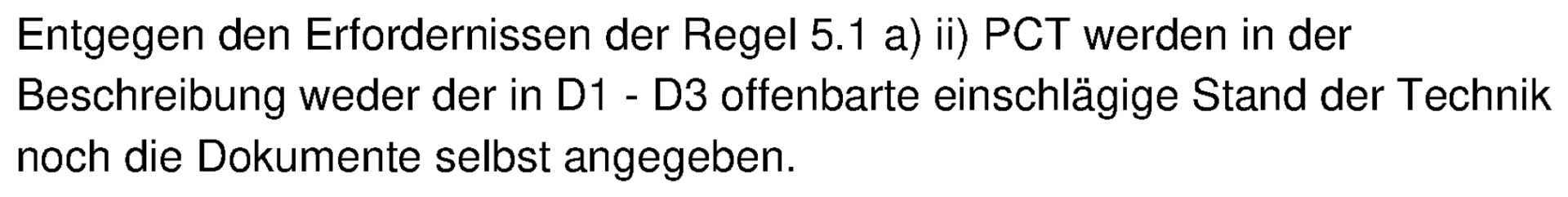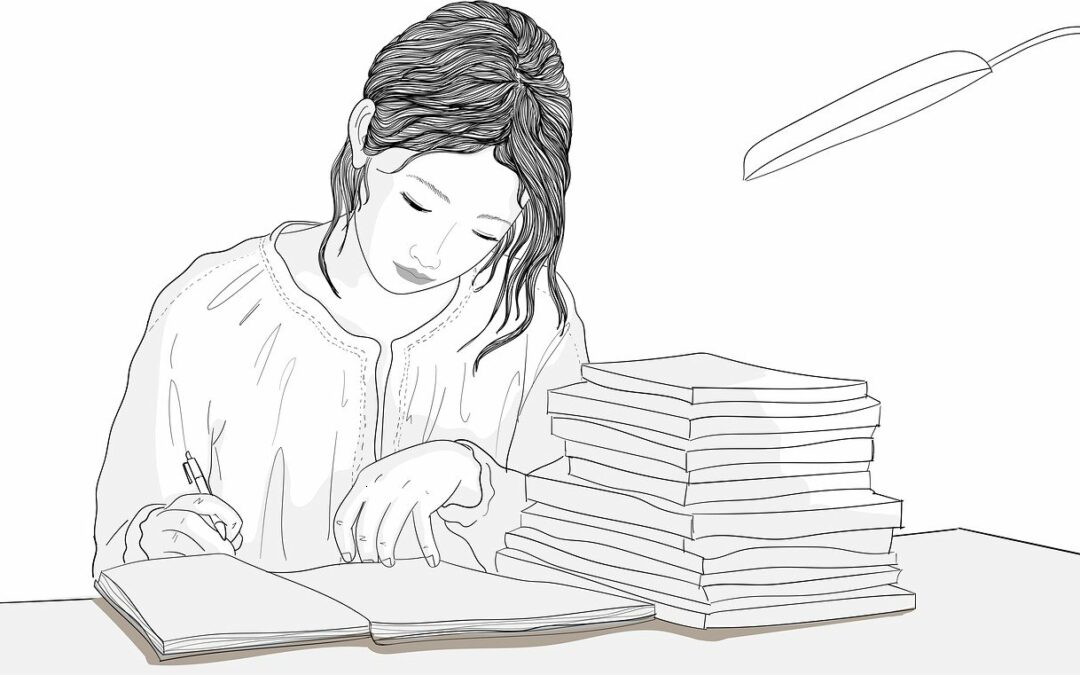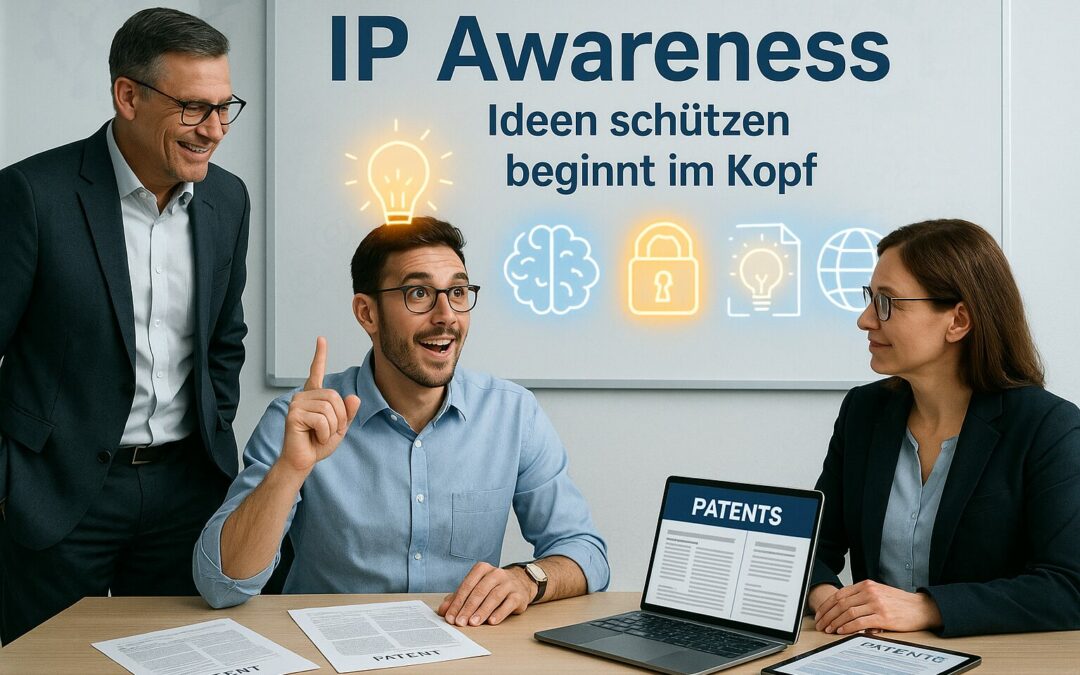
IP Awareness: Wie man (Patent-) Bewusstsein im Unternehmen stärkt
In diesem Artikel geht es darum, wie IP unternehmensweit sichtbar werden kann.
Um Gedankenanstöße. Um meine Erfahrungen. Und um einen ganzheitlichen Blick auf das Thema.
Dabei gehe ich hauptsächlich auf Patente ein, weil dies (oft) die größte Zielgruppe im Unternehmen betrifft und weil (oft) für Patente am meisten Geld ausgegeben wird. Ich hätte es auch stärker eingrenzen und „Patent Awareness“ oder „Patentbewusstsein“ nennen können – diese Bezeichnungen sind aber nicht so geläufig. Letztendlich kann man jedoch auch viele Dinge, die ich anspreche, auf andere Schutzrechte / anderes geistiges Eigentum übertragen. Denn: IP betrifft natürlich noch mehr als Patente, z.B. Marken und Designs, Sortenschutz, Halbleiterschutz, Urheberrecht, Geschäftsgeheimnisse, Geografische Herkunftsangaben usw.
Wie fehlendes Bewusstsein IP-Wert vernichtet
„𝐏𝐚𝐭𝐞𝐧𝐭𝐞? 𝐌𝐚𝐜𝐡𝐭 𝐛𝐞𝐢 𝐮𝐧𝐬 𝐝𝐢𝐞 𝐏𝐚𝐭𝐞𝐧𝐭𝐚𝐛𝐭𝐞𝐢𝐥𝐮𝐧𝐠.“
Ein harmloser Satz. Und ein teurer Irrtum.
Solange IP (Intellectual Property) als 𝐍𝐢𝐬𝐜𝐡𝐞𝐧𝐭𝐡𝐞𝐦𝐚 gilt, bleibt vieles 𝐮𝐧𝐬𝐢𝐜𝐡𝐭𝐛𝐚𝐫:
– Risiken, die nicht erkannt werden.
– Technische Ideen, die im Tagesgeschäft untergehen.
– Wissen über IP, das nicht geteilt wird.
Oft geschieht genau das:
Etliche 𝐈𝐝𝐞𝐞𝐧 𝐯𝐞𝐫𝐬𝐜𝐡𝐰𝐢𝐧𝐝𝐞𝐧 𝐢𝐧 𝐝𝐞𝐫 𝐒𝐜𝐡𝐮𝐛𝐥𝐚𝐝𝐞 – 𝐬𝐢𝐞 𝐞𝐫𝐫𝐞𝐢𝐜𝐡𝐞𝐧 𝐝𝐢𝐞 𝐏𝐚𝐭𝐞𝐧𝐭𝐚𝐛𝐭𝐞𝐢𝐥𝐮𝐧𝐠 𝐠𝐚𝐫 𝐧𝐢𝐜𝐡𝐭.
Andere werden 𝐞𝐱𝐭𝐞𝐫𝐧 𝐠𝐞𝐳𝐞𝐢𝐠𝐭, bevor jemand ihren Schutzwert erkannt hat.
Und wenn später gefragt wird: „𝐇𝐚𝐛𝐞𝐧 𝐰𝐢𝐫 𝐝𝐚 𝐰𝐚𝐬 𝐚𝐧𝐠𝐞𝐦𝐞𝐥𝐝𝐞𝐭?“ – ist es meist zu spät.
IP Awareness bedeutet nicht, dass alle Mitarbeiter Patente erklären können.
Es bedeutet: 𝐈𝐏 𝐰𝐢𝐫𝐝 𝐦𝐢𝐭𝐠𝐞𝐝𝐚𝐜𝐡𝐭. 𝐈𝐦 𝐀𝐥𝐥𝐭𝐚𝐠. 𝐈𝐧 𝐌𝐞𝐞𝐭𝐢𝐧𝐠𝐬. 𝐈𝐧 𝐄𝐧𝐭𝐬𝐜𝐡𝐞𝐢𝐝𝐮𝐧𝐠𝐞𝐧.
Dort beginnt 𝐖𝐞𝐫𝐭𝐬𝐜𝐡ö𝐩𝐟𝐮𝐧𝐠.
Oder sie bleibt aus – obwohl die Voraussetzungen da wären.
IP Awareness bedeutet:
IP (Patente) wird/werden mitgedacht. Im Alltag. In Meetings. In Entscheidungen.
Wer braucht eigentlich IP Awareness und wozu?
„𝐔𝐧𝐬𝐞𝐫𝐞 𝐋𝐞𝐮𝐭𝐞 𝐰𝐢𝐬𝐬𝐞𝐧 𝐝𝐨𝐜𝐡, 𝐝𝐚𝐬𝐬 𝐞𝐬 𝐏𝐚𝐭𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐠𝐢𝐛𝐭.“
Mag sein.
Aber wissen sie auch, wann sie im Alltag wichtig werden?
IP Awareness ist keine Einheitsveranstaltung.
Was ein Entwickler wissen muss, ist etwas anderes als das, was für Führungskräfte, Vertrieb oder Einkauf relevant ist.
Ein paar Beispiele:
– 𝐅&𝐄 braucht das Gespür, wann eine technische Lösung möglicherweise schutzfähig ist (bevor sie gezeigt wird) und wann sie über eine mögliche Schutzrechtsverletzung stolpern.
– 𝐄𝐢𝐧𝐤𝐚𝐮𝐟 muss wissen, welche Risiken durch Lizenzverträge oder Schutzrechtsverletzungen entstehen können.
– 𝐌𝐚𝐫𝐤𝐞𝐭𝐢𝐧𝐠 sollte verstehen, was man über Funktionen sagen darf – und was nicht.
– 𝐅ü𝐡𝐫𝐮𝐧𝐠𝐬𝐤𝐫ä𝐟𝐭𝐞 brauchen ein Auge dafür, ob Teams IP-Chancen überhaupt erkennen – oder sie systematisch übersehen.
𝐈𝐏 𝐀𝐰𝐚𝐫𝐞𝐧𝐞𝐬𝐬 𝐢𝐬𝐭 𝐤𝐨𝐧𝐭𝐞𝐱𝐭𝐚𝐛𝐡ä𝐧𝐠𝐢𝐠.
Wer alle mit denselben Inhalten schult, erzeugt kein Bewusstsein, sondern Überforderung.
Bessere Fragen wären:
– Was muss diese Rolle über IP wissen, um gute Entscheidungen zu treffen?
– Wie erkenne ich IP-relevante Situationen – ohne selbst absoluter Experte zu sein?
𝐆𝐮𝐭𝐞 𝐀𝐰𝐚𝐫𝐞𝐧𝐞𝐬𝐬-𝐒𝐭𝐫𝐚𝐭𝐞𝐠𝐢𝐞𝐧 𝐝𝐢𝐟𝐟𝐞𝐫𝐞𝐧𝐳𝐢𝐞𝐫𝐞𝐧.
Und sie verbinden. Denn IP betrifft oft genau die Schnittstellen, an denen niemand zuständig ist oder sich zuständig fühlt.
IP Awareness ist kontextabhängig.
Das System entscheidet: Warum Einzelmaßnahmen keine Awareness schaffen
„Wir haben doch letztes Jahr ein IP-Webinar gemacht.“
„Die Leute wissen Bescheid – steht alles im Intranet.“
Kommt dir das bekannt vor?
Viele IP-Verantwortliche investieren viel Energie in Schulungen, Info-Mails oder Awareness-Kampagnen.
Und doch 𝐯𝐞𝐫ä𝐧𝐝𝐞𝐫𝐭 sich leider 𝐤𝐚𝐮𝐦 𝐞𝐭𝐰𝐚𝐬.
𝐃𝐞𝐫 𝐆𝐫𝐮𝐧𝐝 𝐢𝐬𝐭 𝐞𝐢𝐧𝐟𝐚𝐜𝐡:
Awareness entsteht nicht durch Information, sondern durch Integration.
Wenn IP nur als Thema „zum Drüberschütten“ behandelt wird, erzeugt das bestenfalls Pflichtwissen.
Doch was wirklich fehlt, ist 𝐕𝐞𝐫𝐚𝐧𝐤𝐞𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐢𝐦 𝐀𝐥𝐥𝐭𝐚𝐠:
– In Projektabläufen.
– In Rollenbeschreibungen.
– In Führungsgesprächen.
𝐈𝐏 𝐀𝐰𝐚𝐫𝐞𝐧𝐞𝐬𝐬 𝐢𝐬𝐭 𝐤𝐞𝐢𝐧𝐞 𝐀𝐮𝐟𝐠𝐚𝐛𝐞 𝐟ü𝐫 𝐝𝐢𝐞 𝐏𝐚𝐭𝐞𝐧𝐭𝐚𝐛𝐭𝐞𝐢𝐥𝐮𝐧𝐠 𝐚𝐥𝐥𝐞𝐢𝐧.
Sie ist eine systemische Herausforderung:
Wenn Strukturen IP ausblenden, helfen auch die besten Schulungen nicht.
Die entscheidenden Fragen lauten:
– Wo ist IP heute im System sichtbar verankert – und wo nicht?
– Gibt es Prozesse, bei denen IP mitgedacht werden müsste – aber nicht wird?
– Und wie wird IP Awareness im Unternehmen lebendig gehalten – jenseits von Einmal-Maßnahmen?
𝐄𝐫𝐬𝐭 𝐰𝐞𝐧𝐧 𝐝𝐚𝐬 𝐒𝐲𝐬𝐭𝐞𝐦 𝐦𝐢𝐭𝐳𝐢𝐞𝐡𝐭, 𝐰𝐢𝐫𝐝 𝐈𝐏 𝐳𝐮 𝐞𝐢𝐧𝐞𝐦 𝐞𝐜𝐡𝐭𝐞𝐧 𝐔𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐞𝐡𝐦𝐞𝐧𝐬𝐰𝐞𝐫𝐭.
Vorher bleibt es: Spezialwissen in der Nebenrolle.
Erst wenn das System mitzieht, wird IP zu einem echten Unternehmenswert.
Wo steht die Organisation auf der Awareness-Skala?
In Gesprächen mit Unternehmen über ihre aktuellen Herausforderungen mit IP, über Strukturen und Vorgehensweisen, ist mir immer wieder etwas aufgefallen:
Es gibt 𝐮𝐧𝐭𝐞𝐫𝐬𝐜𝐡𝐢𝐞𝐝𝐥𝐢𝐜𝐡𝐞 𝐇𝐚𝐥𝐭𝐮𝐧𝐠𝐞𝐧 𝐮𝐧𝐝 𝐑𝐨𝐥𝐥𝐞𝐧𝐯𝐞𝐫𝐬𝐭ä𝐧𝐝𝐧𝐢𝐬𝐬𝐞, die stark beeinflussen, wie IP im Unternehmen gelebt wird.
Besonders sichtbar wird das zwischen 𝐏𝐚𝐭𝐞𝐧𝐭𝐚𝐛𝐭𝐞𝐢𝐥𝐮𝐧𝐠, 𝐅&𝐄 𝐮𝐧𝐝 𝐆𝐞𝐬𝐜𝐡ä𝐟𝐭𝐬𝐟ü𝐡𝐫𝐮𝐧𝐠.
Mit der Zeit habe ich ein Muster erkannt – und daraus ein Modell entwickelt, das sich in vielen Organisationen wiederfindet:
—
𝐒𝐭𝐮𝐟𝐞 𝟏: 𝐃𝐢𝐬𝐭𝐚𝐧𝐳 𝐮𝐧𝐝 𝐒𝐢𝐥𝐨𝐝𝐞𝐧𝐤𝐞𝐧
IP ist getrennt vom Kerngeschäft.
Die Patentabteilung arbeitet „für sich“, F&E sieht sich nicht zuständig, die Geschäftsführung blendet IP aus – bewusst oder unbewusst.
Austausch findet kaum statt.
𝐒𝐭𝐮𝐟𝐞 𝟐: 𝐒𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐌𝐢𝐧𝐝𝐬𝐞𝐭
IP ist sichtbarer geworden. Die Patentabteilung bietet aktiv Leistungen an, geht in die Kommunikation, zeigt Präsenz.
Aber: Es bleibt oft bei der Haltung „Wir sind da – kommt, wenn ihr uns braucht.“
Die Verantwortung liegt weiterhin bei „den anderen“.
𝐒𝐭𝐮𝐟𝐞 𝟑: 𝐆𝐞𝐦𝐞𝐢𝐧𝐬𝐚𝐦𝐞 𝐖𝐞𝐫𝐭𝐬𝐜𝐡ö𝐩𝐟𝐮𝐧𝐠
IP ist nicht mehr nur Support – sondern integrativer Teil der Strategie, der Prozesse, der Sprache.
𝐀𝐥𝐥𝐞 𝐁𝐞𝐭𝐞𝐢𝐥𝐢𝐠𝐭𝐞𝐧 𝐬𝐞𝐡𝐞𝐧 𝐬𝐢𝐜𝐡 𝐚𝐥𝐬 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐧𝐞𝐫 𝐢𝐦 𝐄𝐫𝐬𝐜𝐡𝐚𝐟𝐟𝐞𝐧 𝐯𝐨𝐧 𝐖𝐞𝐫𝐭.
Es geht nicht mehr um Zuarbeit oder das „Abholen“ von F&E – sondern um 𝐠𝐞𝐦𝐞𝐢𝐧𝐬𝐚𝐦𝐞 𝐕𝐞𝐫𝐚𝐧𝐭𝐰𝐨𝐫𝐭𝐮𝐧𝐠.
Die Patentabteilung bringt ihr Fachwissen ein, F&E ihr technisches Verständnis, die Geschäftsführung den strategischen Rahmen – 𝐠𝐥𝐞𝐢𝐜𝐡𝐰𝐞𝐫𝐭𝐢𝐠, 𝐧𝐢𝐜𝐡𝐭 𝐡𝐢𝐞𝐫𝐚𝐫𝐜𝐡𝐢𝐬𝐜𝐡.
—
Ich sehe in vielen Unternehmen 𝐁𝐞𝐰𝐞𝐠𝐮𝐧𝐠 𝐯𝐨𝐧 𝐒𝐭𝐮𝐟𝐞 𝟏 𝐧𝐚𝐜𝐡 𝟐 – häufig ausgelöst durch den Wunsch, mehr und bessere Erfindungsmeldungen zu erhalten.
Dann wird an 𝐒𝐢𝐜𝐡𝐭𝐛𝐚𝐫𝐤𝐞𝐢𝐭 𝐮𝐧𝐝 𝐊𝐨𝐦𝐦𝐮𝐧𝐢𝐤𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 gearbeitet – was wichtig ist.
Aber ohne einen tieferen Mindset-Shift bleibt es beim „Service-Angebot“, das aktiv beworben werden muss.
𝐆𝐞𝐦𝐞𝐢𝐧𝐬𝐚𝐦𝐞 𝐖𝐞𝐫𝐭𝐬𝐜𝐡ö𝐩𝐟𝐮𝐧𝐠 𝐛𝐫𝐚𝐮𝐜𝐡𝐭 𝐦𝐞𝐡𝐫: Vertrauen, Reife – und manchmal einen strukturellen Schritt. Vor allem aber braucht sie ein 𝐧𝐞𝐮𝐞𝐬 𝐕𝐞𝐫𝐬𝐭ä𝐧𝐝𝐧𝐢𝐬 𝐯𝐨𝐧 𝐙𝐮𝐬𝐚𝐦𝐦𝐞𝐧𝐚𝐫𝐛𝐞𝐢𝐭.
Mir ist wichtig:
Das Modell ist kein Urteil, sondern ein Werkzeug zur Reflexion.
Viele Organisationen bewegen sich gleichzeitig auf mehreren Stufen – je nach Standort, Team oder Bereich.
IP Awareness entwickelt sich in Stufen:
Von einem Silo-Denken hin zu gemeinsamer Wertschöpfung.
IP Awareness mit 3 Säulen für mehr Wirkung
IP Awareness entsteht nicht durch ein einzelnes Training.
Und sie bleibt nicht durch einen Intranet-Link oder eine Kampagne.
Meine Gedanken und Erfahrungen dazu:
IP Awareness trägt dauerhaft, wenn 𝐝𝐫𝐞𝐢 𝐁𝐞𝐫𝐞𝐢𝐜𝐡𝐞 im Unternehmen zusammenspielen.
𝟏. 𝐒𝐢𝐜𝐡𝐭𝐛𝐚𝐫𝐤𝐞𝐢𝐭 – damit IP überhaupt wahrgenommen wird
Wenn IP nicht präsent ist, wird es nicht mitgedacht.
Sichtbarkeit heißt: Die IP-Abteilung ist erlebbar, ansprechbar und wird als relevant wahrgenommen.
Was wirkt:
– Präsenz im Intranet, bei Projektstarts, Teamrunden, Onboardings
– klare, zugängliche Sprache
– Erfolgsgeschichten, Identifikationsfiguren, wiedererkennbare Kontaktpunkte
– regelmäßige Angebote, wie z.B. IP- / Patent- Sprechstunden
Sichtbarkeit ist mehr als Information. Sie schafft Aufmerksamkeit und öffnet Türen.
𝟐. 𝐖𝐢𝐬𝐬𝐞𝐧 – damit IP verstanden, erinnert und im Alltag genutzt wird
IP kann nur dann mitgedacht werden, wenn es grundlegend verstanden wird.
Dieses Grundverständnis ist der Schlüssel:
→ Es erklärt, warum IP überhaupt relevant ist – und wofür es sich lohnt, Verantwortung zu übernehmen.
→ Es bildet die Basis für Motivation, Beteiligung und Risikobewusstsein.
Was wirkt:
– Praxisnahe, transferorientierte Formate mit Fallbeispielen, Denkstützen oder kleinen Übungen
– Rollenspezifische Auffrischer, regelmäßig
– IP-Grundlagen als Teil des Onboardings
Wissen sollte so vermittelt werden, dass es verständlich ist – und an die eigene Arbeit anschlussfähig.
Das bedeutet: Nicht abstrakt, sondern konkret. Nicht belehrend, sondern nutzbar.
Verankertes Wissen schafft Verständnis und öffnet den Weg zu eigenverantwortlichem Handeln.
𝟑. 𝐒𝐲𝐬𝐭𝐞𝐦𝐞𝐢𝐧𝐛𝐢𝐧𝐝𝐮𝐧𝐠 – damit IP konsequent mitgedacht wird
Was nicht im Ablauf vorgesehen ist, wird selten konsequent gemacht.
Deshalb muss IP in Strukturen, Routinen und Rollen explizit eingebunden sein.
Was wirkt:
– feste „Touchpoints“ im Projektverlauf (z. B. bei Gates, Kick-offs, Freigaben)
– Führungskräfte, die IP-Themen aktiv ansprechen
– IP Ambassadors, die in Teams sichtbar wirken
– Checklisten mit IP-Fragen
Systemintegration bedeutet: IP ist kein Zusatzthema mehr, sondern ein Bestandteil der unternehmerischen Realität.
3 Säulen von IP Awareness:
Sichtbarkeit erzeugt Aufmerksamkeit.
Verankertes Wissen erzeugt Verständnis.
Systemeinbindung erzeugt Verhalten.
IP-Awareness ist kein Sprint. Sondern ein Weg.
In Gesprächen mit IP-Verantwortlichen höre ich oft diesen Satz:
„𝐃𝐚𝐬 𝐤𝐥𝐢𝐧𝐠𝐭 𝐣𝐚 𝐢𝐧 𝐝𝐞𝐫 𝐓𝐡𝐞𝐨𝐫𝐢𝐞 𝐚𝐥𝐥𝐞𝐬 𝐠𝐮𝐭 – 𝐚𝐛𝐞𝐫 𝐛𝐞𝐢 𝐮𝐧𝐬 𝐢𝐬𝐭 𝐝𝐚𝐬 𝐧𝐢𝐜𝐡𝐭 𝐬𝐨 𝐞𝐢𝐧𝐟𝐚𝐜𝐡 𝐮𝐦𝐳𝐮𝐬𝐞𝐭𝐳𝐞𝐧.“
Und ehrlich gesagt:
Ich verstehe das.
Denn auch ich sehe in vielen Unternehmen, 𝐰𝐢𝐞 𝐦ü𝐡𝐬𝐚𝐦 𝐝𝐢𝐞𝐬𝐞𝐫 𝐖𝐞𝐠 𝐦𝐚𝐧𝐜𝐡𝐦𝐚𝐥 𝐢𝐬𝐭.
Die Führung hat andere Themen.
Entwickler haben keine Zeit für Seminare.
Man gibt sich Mühe – und dann kommt: nichts. Oder zumindest nicht das, was man erhofft hat.
Ich glaube:
𝐈𝐏 𝐀𝐰𝐚𝐫𝐞𝐧𝐞𝐬𝐬 𝐢𝐬𝐭 𝐤𝐞𝐢𝐧 𝐒𝐩𝐫𝐢𝐧𝐭. 𝐒𝐢𝐞 𝐢𝐬𝐭 𝐞𝐢𝐧 𝐌𝐚𝐫𝐚𝐭𝐡𝐨𝐧.
Und manchmal fühlt sie sich an wie ein Trailrun im Nebel.
Man probiert Dinge aus.
Manches funktioniert gut – anderes passt (noch) nicht zur Kultur, zur Sprache, zum Timing.
Manchmal gibt es einen plötzlichen Anstieg an Erfindungsmeldungen und dann wieder einen Rückgang, der frustriert.
Das ist normal.
Es geht nicht darum, sofort anzukommen, sondern sich auf den 𝐖𝐞𝐠 𝐢𝐧 𝐝𝐢𝐞 𝐫𝐢𝐜𝐡𝐭𝐢𝐠𝐞 𝐑𝐢𝐜𝐡𝐭𝐮𝐧𝐠 zu machen.
Denn 𝐈𝐏 𝐀𝐰𝐚𝐫𝐞𝐧𝐞𝐬𝐬 𝐢𝐬𝐭 𝐤𝐞𝐢𝐧𝐞 𝐌𝐚ß𝐧𝐚𝐡𝐦𝐞, 𝐬𝐨𝐧𝐝𝐞𝐫𝐧 𝐞𝐢𝐧 𝐊𝐮𝐥𝐭𝐮𝐫𝐰𝐚𝐧𝐝𝐞𝐥.
Und der verläuft nie geradlinig.
Wichtig ist aus meiner Sicht:
– Dranbleiben.
– Anpassen.
– Mit sich selbst und anderen 𝐟𝐫𝐞𝐮𝐧𝐝𝐥𝐢𝐜𝐡 𝐮𝐧𝐝 𝐫𝐞𝐚𝐥𝐢𝐬𝐭𝐢𝐬𝐜𝐡 umgehen.
Es bewegt sich etwas, auch wenn es nicht sofort sichtbar wird.
Und der größte Fortschritt ist manchmal: 𝐞𝐢𝐧𝐞 𝐇𝐚𝐥𝐭𝐮𝐧𝐠, 𝐝𝐢𝐞 𝐛𝐥𝐞𝐢𝐛𝐭 –
auch wenn alles andere sich noch nicht vollständig gefunden hat.
Fazit: IP Awareness ist ein Entwicklungsprozess
Wer Patentbewusstsein in Unternehmen schaffen möchte, ist auf dem richtigen Weg. Denn Patentbewusstsein wird das Unternehmen, ihre Innovationen und letztendlich ihren Marktwert stärken.
Doch wie macht man es „richtig“?
Schau dir die verschiedenen Stellschrauben im Unternehmen an. Wo steht ihr aktuell und was könntet ihr verändern?
Sieh es als Prozess, der sich langsam entwickelt. Hab Geduld. Es muss nicht gleich morgen alles zu 100% stehen (das wird sowieso nie möglich sein).
Wenn du dabei Unterstützung brauchst, sprich mich gerne an. Ich bin gerne dein Reflexions- und Denkpartner in dieser Sache. Insbesondere beim Thema Wissensaufbau kann ich dir zur Seite stehen. Meine Trainings sind ein optimaler Einstieg. Denn bei mir geht es nicht nur darum, Wissen zu vermitteln, sondern auch darum, es mit individuellen Beispielen, Übungen und Fragetechniken Prozesse in Gang zu bringen, die eine nachhaltige Wirkung erzeugen können. Buch dir für ein Kennenlerngespräch dazu gerne einen Termin (hier geht’s zur Buchung).